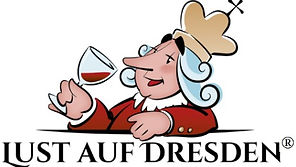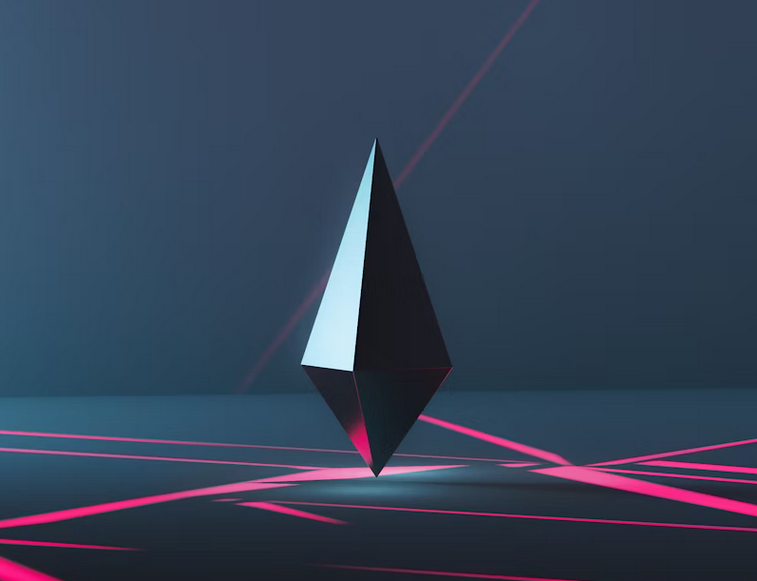Fachjargon beim Arzt: Die wichtigsten Begriffe erklärt
- Anzeige / Partnereintrag

- 6. Mai 2025
- 3 Min. Lesezeit
Fachjargon beim Arzt einfach erklärt
Lateinunterricht. Diagnose: benigne Hyperplasie oder akute Tonsillitis. Hä? Während der Arzt bereits zum nächsten Punkt übergeht, bleibt im Kopf nur ein großes Fragezeichen.
Medizinischer Fachjargon ist für Ärztinnen und Ärzte Alltag, für viele andere jedoch ein Rätsel. Dabei wäre es so hilfreich, genau zu wissen, was im Körper vor sich geht. Dieser Artikel übersetzt die wichtigsten Begriffe – klar, verständlich und ohne Fachchinesisch. Denn Wissen beruhigt, besonders wenn’s um die Gesundheit geht.
Diagnosen-Deutsch: Was steht da eigentlich auf dem Zettel?
Ein Blick auf den Arztbrief genügt, und schon tauchen Begriffe auf wie akut, chronisch, benigne oder maligne. Klingt kompliziert, ist aber meist einfacher, als es wirkt. Akut heißt schlicht „plötzlich auftretend“, während chronisch bedeutet, dass etwas dauerhaft besteht.
Benigne steht für „gutartig“, maligne hingegen für „bösartig“. Besonders letzteres sorgt oft für Unruhe – dabei muss es nicht immer gleich schlimm sein, je nach Zusammenhang. Auch Wörter wie rezidivierend (wiederkehrend) oder asymptomatisch (ohne Beschwerden) sind gängige Begriffe, die häufig in Befunden auftauchen. Inzwischen gibt es sogar Anbieter für die Übersetzung medizinischer Befunde, die Patienten unterstützen.
Wer die wichtigsten Vokabeln kennt, ist klar im Vorteil – und kann besser einschätzen, was wirklich los ist. Denn nicht alles, was medizinisch kompliziert klingt, ist auch automatisch bedrohlich.
Laborwerte und Abkürzungen: Die geheime Sprache der Blutwerte
Ein Blutbild kann wie ein Buch mit sieben Siegeln wirken – voller Abkürzungen und Zahlen. CRP, LDL, Hb, TSH – was heißt das eigentlich alles? CRP steht zum Beispiel für einen Entzündungswert, LDL ist das „schlechte“ Cholesterin, Hb zeigt den Hämoglobinwert (also den Sauerstofftransport im Blut) und TSH gibt Hinweise auf die Schilddrüse. Dabei gilt: Ein einzelner Wert sagt noch nicht alles – die Zusammenschau ist entscheidend.
Auch Begriffe wie Leukozyten (weiße Blutkörperchen) oder Thrombozyten (Blutplättchen) tauchen dort auf. Wichtig ist, sich nicht von roten Zahlen oder vermeintlich „abnormalen“ Werten verunsichern zu lassen. Die Interpretation gehört in ärztliche Hände – aber ein bisschen Hintergrundwissen schadet nie und hilft beim besseren Verständnis der eigenen Gesundheit.
Medikamente und Dosierungen: Vom Placebo bis zum Retardpräparat
Medikamente kommen oft mit einem Beipackzettel, der fast so viele Fragezeichen hinterlässt wie die Krankheit selbst. Was bedeutet z. B. Retardpräparat? Ganz einfach: ein Mittel, das den Wirkstoff verzögert abgibt – also über längere Zeit wirkt. p.o. heißt „per os“, also „zum Einnehmen“, i.v. steht für „intravenös“ – also direkt in die Vene. Auch die berühmten Dosierungsangaben wie 1-0-1 haben System: Morgens eine Tablette, mittags keine, abends eine.
Generika sind übrigens günstige Nachahmerpräparate von Originalmedikamenten – gleich wirksam, nur preiswerter. Begriffe wie Placebo (Scheinmedikament) oder Indikation (Anwendungsgrund) sind ebenfalls hilfreich zu kennen. Wer die Sprache der Medikamente versteht, fühlt sich sicherer – besonders im Alltag mit Dauermedikation oder neuen Therapien.
Bildgebung und Befunde: MRT, CT und das ominöse Infiltrat
Röntgenbild, MRT oder CT – alles gar nicht so einfach. Die bildgebende Diagnostik bringt oft Begriffe mit sich, die abschrecken. Da ist zum Beispiel von einem Infiltrat die Rede, was einfach auf eine Gewebeveränderung hinweist, etwa durch Entzündung. Ödem bedeutet eine Flüssigkeitsansammlung im Gewebe, Hyperplasie bezeichnet eine Vergrößerung eines Organs oder Gewebes durch Zellvermehrung – nicht automatisch gefährlich.
Die Abkürzung MRT steht für Magnetresonanztomographie, CT für Computertomographie – beides Verfahren, um in den Körper zu schauen. Der Befund klingt oft dramatischer, als er ist. Deshalb ist es hilfreich, sich die wichtigsten Begriffe erklären zu lassen oder vorab nachzulesen. Denn wer weiß, was gemeint ist, muss sich weniger Sorgen machen – und kann besser mitentscheiden.
Keine Panik bei Fachsprache
Medizinische Fachbegriffe wirken oft einschüchternd, sind aber meist gut erklärbar. Ein kurzer Blick hinter die Wortkulissen reicht oft schon, um Zusammenhänge besser zu verstehen. Wer unsicher ist, sollte ohne Scheu nachfragen – schließlich geht es um die eigene Gesundheit. Ärzte und Ärztinnen erklären in der Regel gern. Ein bisschen Vokabeltraining schadet nicht – und sorgt für mehr Klarheit im Wartezimmer und darüber hinaus.